Die Tagung In Sack und Tüten!? hat Raum geschaffen Erfahrungen und Lösungsansätze auszutauschen

Teilnehmendenzahl: 300
Vom 17. – 20. September 2025 luden die Fachgruppen Kunsthandwerkliche Objekte und Präventive Konservierung des Verbands der Restauratoren in Berlin zur Tagung „In Sack und Tüten!? Aspekte der Sammlungspflege II – Verpackung von Kunst- und Kulturgut“ ein.
Mit einer Mischung aus 20 nationalen und internationalen Vorträgen, einer Poster Session mit 12 Postern und 6 Messeständen, die in den Pausen besucht werden konnten, war die Veranstaltung mit einer großen Vielfalt an Aspekten und Perspektiven aufgestellt, die alle ihren Beitrag zum Thema der Tagung leisteten: der Verpackung von Kunst und Kulturgut.
Ein Thema, das oft unterschätzt wird, aber von großer Bedeutung ist und in verschiedenen interdisziplinär agierenden Berufsgruppen große Resonanz erfuhr. So war der Veranstaltungsort, das Audimax der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, ab dem ersten Tag voll besetzt mit Teilnehmenden verschiedener Fachausrichtungen.
Besonders die Poster Session und die Stände von Kunstlogistikunternehmen, Kunstversicherungen und Produktherstellern mit ihrem praktischen Anschauungsmaterial luden zum Austausch ein und sorgten für eine aufgelockerte Atmosphäre, die eine Vernetzung unter den Tagungsteilnehmenden förderte und gleichzeitig direkt an die Praxis anknüpfte.
Für den dritten Tag waren mehrere Führungen in verschiedene Depots und Museen Berlins und Potsdams vorgesehen, die einen interessanten Einblick in die zum Teil im Vorfeld vorgestellten Orte oder Projekte gewährten.


Mit vereinten Kräften
Alle vorgestellten Projekte machten eines deutlich: Kunsttransporte und Depotumzüge sind Kraftanstrengungen. In vielen Fällen handelt es sich nicht nur um Objektkonvolute unterschiedlicher Gattungen und Größen, sondern meistens auch um eine große Anzahl ab 4.000 Objekten aufwärts. Häufig müssen Umzüge aufgrund von Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden in sehr kurzer Zeit geplant und umgesetzt werden. Einem reibungslosen Ablauf – auch innerhalb eines Museumsgebäudes – stehen oftmals viele Hindernisse im Weg. Türen sind zu niedrig, Wege zu steil für Paletten auf Rollen, Korridore zu schmal für eine problemlose Beförderung von A nach B. Kunst- und Kulturgutlogistik erfordert sehr gute Teamarbeit und auch ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft.
Eine starre Rollenverteilung ist daher nicht mehr zeitgemäß, stattdessen sind verschiedene Perspektiven gefragt. Im Rahmen der Tagung näherten sich die Sichtweisen von Kunstlogistiker:innen, Depotverwalter:innen, Registrar:innen, Museumstechniker:innen; Naturwissenschaftler:innen und Restaurator:innen weiter einander an.
Es bleibt der Eindruck, dass Logistiker:innen heutzutage verstärkt auf die Anforderungen von Restaurator:innen eingehen. Gleichzeitig bedenken Restaurator:innen wiederum intensiver die Perspektive der Logistik. Ein traditionsreiches Kunsttransportunternehmen wie Hasenkamp befürwortet, dass besonders tückische Objekte hinsichtlich ihres Transportes dokumentiert werden sollten, damit 40 Jahre später nicht die gleichen Fehler beim Verpacken und Transport wiederholt werden.
Die Konzeption einer Wanderausstellung des Victoria & Albert Museum setzte genau das um: Für textile Kostüme und Kopfschmucke, Schuhe und Taschen wurden nicht nur hausintern individuell angepasste Transportkisten gebaut, in denen die auf teils sperrigen Figurinen drapierten Kostüme um die Welt flogen, sondern sie verschickten für jedes Objekt auch eine bebilderte Anweisung für das Aus-, und Einpacken.
Bei Objekten, die im Transit durch viele verschiedene Hände gehen, ist eine enge Zusammenarbeit von Spezialist:innen von ganz entscheidender Bedeutung.
Diese Thematik eröffnete im Nachgang die Diskussion, ob es noch Kurierdienste braucht, oder ob Dokumentationen zum Auf- und Abbau eine Kommunikation vis-a-vis ersetzen können.
Jill Plitnikas vom Canadian Conservation Institute (CCI) führte einen weiteren wichtigen Aspekt an. Ihre Aufgabe war es gewesen, ein Museum für indigene Kunst der Kay-Nah-Chi-Wah-Nung im Nordwesten Ontarios mit Equipment, Materialien und praktischen Informationen zu versorgen, damit die Mitarbeitenden und Mitglieder der Community in Eigenregie das Verpacken und den Transport durchführten. In diesem Fall war die Teilhabe am Transport von ebenso großer Bedeutung, wie die Identifizierung mit den Werken.

Weniger Sack und Tüten!?
Ein Kernthema war die Frage nach einer gesteigerten Nachhaltigkeit beim Verpackungsmaterial und einer Widerverwendbarkeit von Kisten. Welche Lösungsansätze gibt es derzeit in der Praxis, wenn Wirtschaftlichkeit weiterhin im Widerspruch zur Nachhaltigkeit steht? Wie ist es zu bewerten, dass Institutionen versuchen, dem Anspruch der Nachhaltigkeit weitgehend durch Materialeinsparung gerecht zu werden?
Recycelte Varianten gegenüber den herkömmlich hergestellten Produkten versprechen leider nicht immer Gutes. Oft enthalten recycelte Produkte Weichmacher und eignen sich daher nicht für die Langzeitlagerung. Oder sie weisen durch die Produktherstellung eine raue Oberfläche auf, die einen Wasseraustausch behindert, wie z. B. recycelte Polyethylen-Folie. Das hatten Rebecca Ellison und Victoria Ward von der UK Museums & Heritage Sustainable Packing Group bei ihren Untersuchungen herausgefunden.
Einige gängige Materialien, die bei der Verpackung von Kunst und Kulturgut Verwendung finden, sind zudem für die Langzeitlagerung von sensiblen Objekten ungeeignet. So zeigte sich eine Lagerung von PU-beschichteten und PVC-beschichteten Textilien unter Tyvek® als äußerst schädlich. Joana Tómas Ferreira, Doktorandin am Department of Conservation and Restoration der NOVA University of Lisbon – School of Science and Technology empfiehlt stattdessen in den meisten Fällen eine Abdeckung mit silikonbeschichteten Materialien wie Papier oder Folie.
Am Landesamt für Bodendenkmalpflege Hessen stellten die Restauratorinnen Christine Henke und Juliane Schmidt fest, dass ein bislang viel genutztes RP-System zum Einschweißen von chloridbelasteten Eisenfunden den gegenteiligen Effekt erzielte, als die Objekte langfristig zu schützen. Die darin enthaltenen Sauerstoffadsorber hatten die Korrosion erst richtig in Gang gesetzt und die Funde dadurch stark geschädigt.
In vielen Vorträgen wurden Zustände dargestellt, die sich im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit, Angebot und Machbarkeit bewegen. Bei einem sehr knappen Budget steht die Nachhaltigkeit oft an letzter Stelle. Zudem wird zwischen temporärer und langfristiger Lagerung unterschieden. Eine temporär geplante Lagerung verbraucht aber sehr viel mehr Material, während eine langfristige Lagerung bei guter Planung (und dem vorhandenen Budget) auf Verpackungsmaterial verzichten kann, wie es Meike Wolters-Rosbach anhand des neuen Depots am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg zeigte.
Es wäre doch die effizienteste Lösung, gar kein Material für die Langzeitlagerung von Objekten verwenden zu müssen und alle Anforderungen über die Depotarchitektur, die Wahl der Ausstattung und nicht zuletzt über einen Putzplan zu regeln, oder!?

Weiterentwicklung bei der Schadstoffkontrolle
Im Zusammenhang von Verpackungs- und Transportmaterial, sowie Baustoffen in Depots braucht es auch eine Schadstoffkontrolle und eine Materialprüfung, um herauszufinden, was auf lange Sicht mit Objekten durch Emissionen geschieht. Ein gängiges Verfahren hierfür ist der bekannte Oddy-Test, der auf dem Prinzip der visuellen Erfassung von Korrosionserscheinungen basiert.
Das Langzeit-Forschungsprojekt MAT-CH (Material Checker) der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Alexandra Jeberien entwickelt den Oddy-Test seit dem Jahr 2016 weiter, um das benötigte Equipment hinsichtlich seiner Anwendung zu vereinfachen, zu verbessern (z. B. größere Reaktionsgläser für größere Materialproben) und zu standardisieren (einheitliche Indikatorplättchen). Auch beim MAT-CH Test basieren die Ergebnisse weiterhin auf der subjektiven Wahrnehmung. Eine Idee ist es, wie bei der modernen Analyse von Hautveränderungen, Korrosionserscheinungen zukünftig KI-basiert auswerten zu können.
Individuelle und modulare Verpackungsmethoden
Transporte von Großplastik gibt es schon seit den alten Ägyptern – das wurde anschaulich von Prof. Dr. Peter Kozub von der TH Köln gezeigt. Ab dem 19. Jahrhundert hatte man nach bestem Wissenstand teilweise sehr kreative Ideen dafür, eine überlebensgroße Skulptur über den Atlantik zu verschiffen. Manche Vorgehensweisen haben sich bis heute aber kaum verändert, wie beispielsweise die Wahl einer individuell für das Objekt konstruierten Kiste, um es vor externen Beschädigungen auf den zum Teil langen und gefährlichen Wegen zu schützen. Statt Objekte zusätzlich in „Polsterflocken“ versinken zu lassen, kommen heute jedoch eher Innenkisten zum Einsatz, die mit Versteifungen aus Holz ausgestattet sind oder in denen die Objekte mit Kunststoff ummantelt werden.
Mit 3D-Verfahren können individuell angepasste Formen (bisher nur in Polystyrol, einem nicht für die Langzeitlagerung geeigneten Material) mit der CNC-Fräse zugeschnitten werden. An der TH Köln wurden die Entwürfe für Verpackungen in einem Projekt mit der 3D-Freeware blender® erstellt, der Scan mit Artec3D. „Eine genaue Planung des Aufbaus einer Verpackung hilft auch beim Identifizieren von möglichen Schwachstellen eines Objektes“, fügte der Referent seinen Antworten auf gestellte Nachfragen hinzu.
Auch wenn die Passgenauigkeit für größtmögliche Stabilität sorgt, stellt sich im Sinne der Nachhaltigkeit die Frage nach einer modularen Gestaltung einer solchen Kistenausstattung, da individuell angepasste Verpackungen schwer wieder zu verwenden sind.
Eine mögliche Antwort darauf könnte in Zukunft die Hasenkamp Internationale Transporte GmbH liefern. Roman Wisst stellte eine innovative Schutzkiste basierend auf dem bewährten Vario-System vor, die viele Wünsche vereinen soll: Flexibilität für unterschiedliche Objektgrößen, leichtes Gewicht, hergestellt aus recycelten oder nachhaltigen Materialien, mit Schwingungsentkopplung und integriertem Klimamessgerät.
Die arca® wurde von Dr.-Ing. Pascal Ziegler mit seinem Team am Institut für Technische und Numerische Mechanik der Universität Stuttgart auf ihre tatsächliche Schwingungsentkopplung unter dem Einfluss verschiedener Schwingungsdynamiken getestet. Das Ergebnis: Die Vario® schneidet bislang noch etwas besser ab. Das liegt vor allem an den Optimierungen hinsichtlich des Gewichtes, die an der arca® vorgenommen wurden. Die Forschungen an der neuen Schutzkiste gehen weiter. Bislang wurde sie auch nur für Gemälde konzipiert, da eine Normierung für 3D-Objekte schwierig ist.
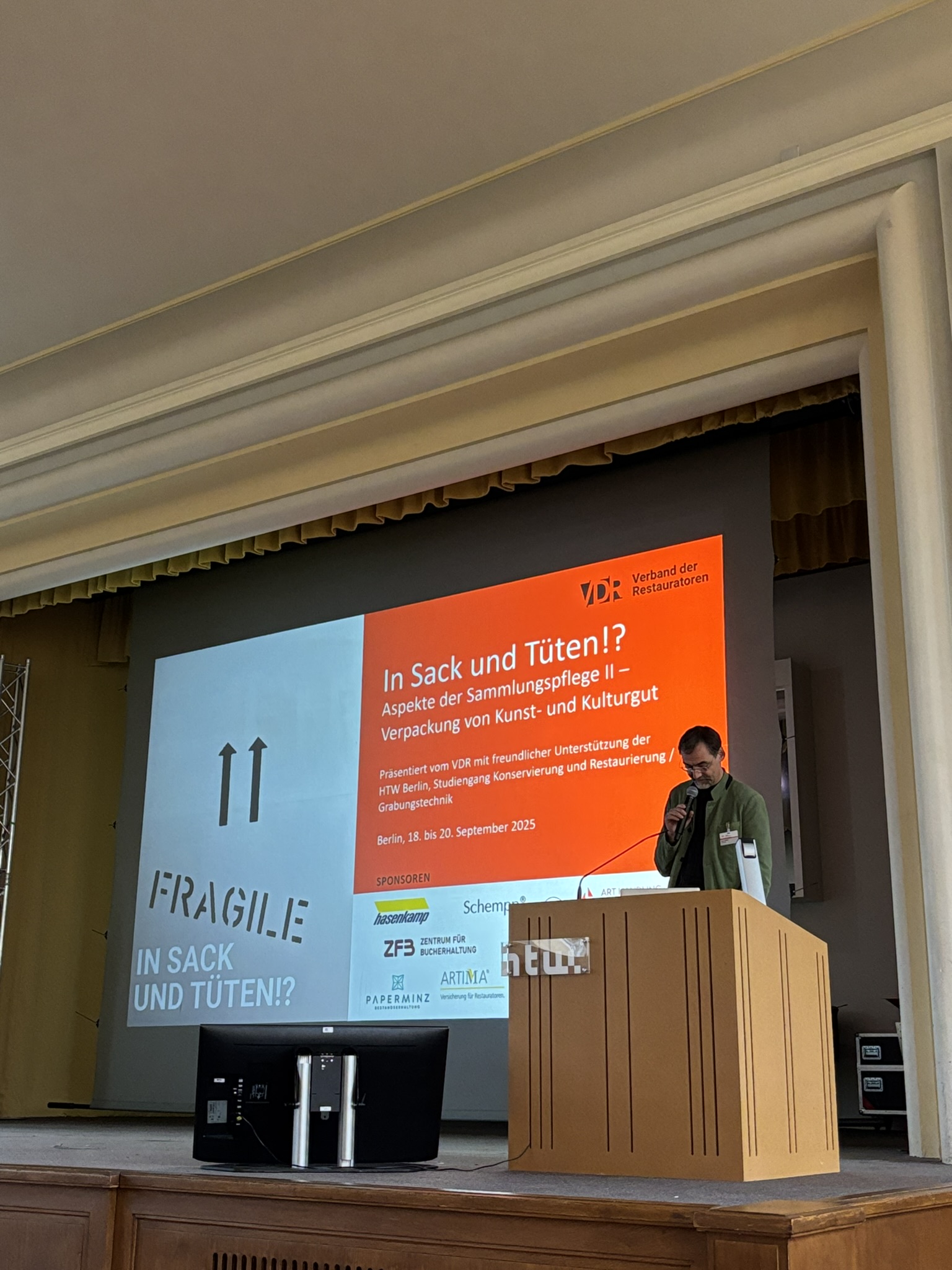

Gute Planung und routinierte Prozesse
Für den gesamten Ablauf von Projekten mit langer Laufzeit und mehreren tausend Objekten ist es wichtig, eine Routine zu finden, sei es für eine Verpackungsstraße oder eine Reinigungsstraße. In der zoologischen Sammlung der Universität Zürich war der Umzug zusätzlich mit einer Dekontamination verbunden: Arsen-, quecksilber-, und pestizidbelastete Objekte erforderten das permanente Arbeiten in Vollschutz. Die Tiefgarage des Museums wurde in kurzer Zeit in Schwarz-, Grau-, und Weißbereich umgebaut. „Die Aufrechterhaltung der Prozessarbeit des Teams war eine der schwierigsten Aufgaben.“ fügte Sirpa Kurz abschließend hinzu.
Empfehlungen zur Planung für Umzugsabläufe lieferte auch Maruchi Yoshida, die als Depotplanerin ihre Erfahrungen als externe Aufragnehmerin teilte. Neben einer nachvollziehbaren Datengrundlage, wie einem Mengengerüst zur Finanzierung, spielt die Kommunikation mit einem hohen Maß für Sendungsbewusstsein intern wie extern eine große Rolle. Dabei sind Visualisierungen der Abläufe ein wichtiges Werkzeug.
Immer noch aktuell und ein weiterer wichtiger Punkt im Prozess: die Prävention des Eintrags von Schädlingen. Durch die Verwendung von Kartonagen, Möbeldecken, Holzkisten beziehungsweise Holzpaletten und natürlich durch bereits befallene Objekte ziehen Schädlinge bei Transporten direkt mit um. Stephan Biebl arbeitet beispielsweise mit mobilen Zelten aus aluminiumbeschichteter Folie zur Einhausung von befallenen Objekten, die einerseits zur Quarantäne und andererseits für eine Behandlung durch Luftentzug dienen.
Maruchi Yoshida stellte für die Schädlingsbehandlung den IPM-Freezer von iconyk vor, der besonders auch für kleinere Museen interessant ist: 1 LKW = 1 Container für Kulturgut. Das spart viele einzelne Verpackungen.
Weimar, den 28.09.2025
Henriette Theurich
Ein herzlicher Dank geht an Herrn Matthias Szarata, den ich mit dem Titel dieses Berichts aus seinem Vortrag zitieren darf.
Dank
Unser großer Dank gilt allen Teilnehmenden und Mitwirkenden dieser Tagung.
Im Besonderen geht der Dank an unseren Kooperationspartner, die HTW Berlin mit Prof. Dr. Jeberien und den Studierenden sowie Frau Harris und ihrem Team. Herzlich danken wir auch allen Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Tagung in diesem Rahmen nicht möglich gewesen wäre:
- hasenkamp
- Schempp Bestandserhaltung
- Art Handling Spedition
- ZFB Zentrum für Bucherhaltung
- Christoph Waller - Long Life for Art & Datenlogger-Store e.K.
- Helmsauer Versicherungsmakler Dr. Schmidt & Erdsiek
- Paperminz Bestandserhaltung
- Artima Versicherung für Restauratoren
- Deffner & Johann
- HALBE-Rahmen
Ebenso danken wir allen Referierenden und Mitwirkenden am Rahmenprogramm. Für die hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung danken wir außerdem der VDR-Geschäftsstelle.
Zu guter Letzt danken wir Henriette Theurich, der Autorin des Nachberichts, sehr herzlich.
Ihr Organisationsteam
Nadine Cheryl Adolfs, Julia Dummer, Solveig Hoffmann, Regina Klee, Laura Petzold, Carina Seidel, Katja Siebel
